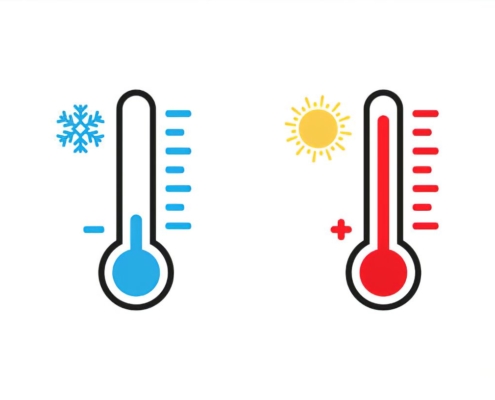Hausarzt gegen Betriebsarzt?
Wer zu seinem Hausarzt geht, geht dahin, um gesund zu werden, wer zum Betriebsarzt geht, geht dahin, um gesund zu bleiben. Der Satz ist zwar sehr vereinfacht, drückt aber in etwa das Verhältnis, beziehungsweise die Aufgaben von Hausarzt und Betriebsarzt aus. Während der eine Kranke von ihren Leiden heilt, muss der andere dafür sorgen, dass überhaupt niemand – zumindest in seinem beruflichen Umfeld – krank wird. Das klingt, als seien Hausarzt in Betriebsarzt natürliche Gegner. Allerdings haben sie auch etwas gemein. Ihr Ziel ist am Ende immer der gesunde Mensch. Im Idealfall arbeiten Hausarzt und Betriebsarzt Hand in Hand. In bestimmten Fällen ist es sogar unabdingbar. Aber es gibt tatsächlich einige Konfliktfelder zwischen Hausarzt und Betriebsarzt. DOKTUS hat einige markiert.
Die Spur des Geldes
Ein ganz grundlegender Unterschied zwischen Haus- und Betriebsarzt betrifft die Honorierung. Hausärzte werden über die Kassenärztliche Vereinigung (KV), hinter der die gesetzlichen Krankenkassen stehen, bezahlt. Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sind angestellt oder erhalten ein Honorar von dem jeweilen Unternehmen, in dem sie tätig sind. Damit scheint ein Interessenkonflikt schon vorprogrammiert zu sein. Der Gedanke liegt nahe, dass sich der Betriebsarzt eher an die Vorgaben der Unternehmensleitung hält. Dieser Vorwurf wird immer mal wieder so formuliert. Umgekehrt könnte man argumentieren, dass sich Hausärzte in erster Linie als Sachwalter der Krankenkassen sehen, die nicht in erster Linie das Wohl ihrer Patienten im Sinn hätten. Sowohl der eine, wie der andere Vorwurf führt ins Leere. Da nur gesunde Mitarbeiter ein gesundes Unternehmen bedingen, wird einem Betriebsarzt immer das gesundheitliche Wohl der Belegschaft am Herzen liegen, ebenso wird ein Hausarzt seine Patienten so gesund wie möglich erhalten wollen, weil jeder Kranke auch die Kassen der Krankenkassen belastet.
Wo die Konfliktfelder liegen
Immer wieder kommt es zu Situationen, in denen Hausarzt und Betriebsarzt zusammenarbeiten müssen. Um gemeinsam agieren zu könne, ist allerdings die ausdrückliche Genehmigung des Patienten notwendig. Schon das unterscheidet die Kommunikation zwischen Haus- und Betriebsärzten von der Kommunikation zwischen Haus- und Fachärzten. Da der Betriebsarzt nicht behandelt, wird er einen erkrankten Beschäftigten auch an dessen Hausarzt weiter verweisen. Umgekehrt passiert das natürlich nicht. Kein Hausarzt wird seinen Patienten an den Betriebsarzt seines Unternehmens verweisen. Zu Konflikten kann es theoretisch auch kommen, wenn es um die gesundheitliche Einschätzung geht. Diese Gefahr besteht am ehesten, wenn es um ein Verfahren im Zuge einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme (BEM) kommt. Das kommt zum Tragen, wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer nach mehrmonatiger Krankheit wieder zurück ins Berufsleben kehren will. Hier ist oft eine medizinische und mentale Begleitung notwendig, vor allem dann, wenn Betroffene gesundheitsbedingt nicht an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren können.
Wie eine gute Zusammenarbeit aussieht
Wenn es absehbar ist, dass eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in einem BEM-Prozess zurück ins Berufsleben begleitet wird, dann sollte die Zusammenarbeit zwischen Hausarzt und Betriebsarzt schon sehr früh beginnen, nämlich noch in der Akutphase. Hier ein Beispiel, wie die Zusammenarbeit funktionieren kann: Dem Hausarzt obliegen in dieser Phase die Diagnostik und die Therapie. Gleichzeitig analysiert der Betriebsarzt den Arbeitsplatz und erstellt eine Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf die mögliche Rückkehr des Erkrankten. Wenn das eigentliche BEM-Verfahren eingeleitet ist, begleitet der Hausarzt den Betroffenen medizinisch und erstellt Gutachten über seinen Zustand. Der Betriebsarzt erstellt nun einen Arbeitsplan, der den Betroffenen in einem angemessenen Tempo wieder an die Arbeit heranführt. Nach dem eigentlichen Abschluss des BEM ist die Arbeit von Hausarzt und Betriebsarzt aber noch nicht getan. Es gibt noch eine Phase der Nachsorge. Hier passt der Hausarzt die entsprechende Therapie an und übernimmt gegebenenfalls die Langzeitbetreuung des Patienten. Der Betriebsarzt wird über ein Monitoring die Arbeitsbelastung des Betroffenen im Auge behalten und gegebenenfalls auch steuern.
An einem Strang ziehen
Die Situation zwischen Hausarzt und Betriebsarzt ist tatsächlich nicht immer einfach. Das liegt schon an der Konstellation. Außer dem Patienten selbst und seinem Hausarzt sind auch Betriebsarzt und Unternehmen beteiligt. Es geht also darum, die Interessen von vier verschiedenen Parteien in Einklang zu bringen. Am Ende müssen alle an einem Strang ziehen, wenn Gesundheit und Arbeitskraft eines Mitarbeitenden wieder herstellt werden soll. Aber am Ende profitieren auch alle davon.
Peter S. Kaspar
Bildquelle: iStock, AndreyPopov