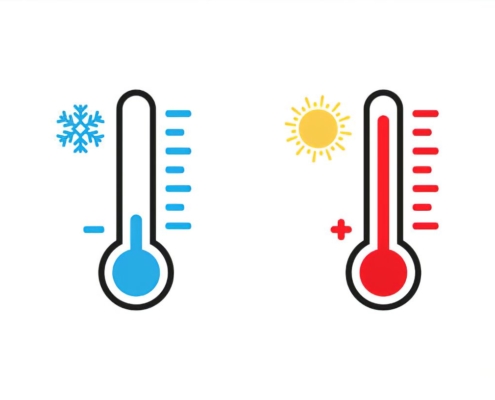Der Fünfjahresplan
Man kennt es noch aus früheren Zeiten, als in sozialistischen Ländern Fünf-Jahrespläne erstellt wurden, mit denen wirtschaftliche Ziele erreicht werden sollten. Vielleicht haben sich deshalb die Mitglieder der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie darauf geeinigt, ihr Ziele, die ebenfalls für einen fünfjährigen Rhythmus formuliert werden, nicht Pläne zu nennen, sondern Perioden. Mit dem Jahr neigt sich nun auch die 3. GDA-Periode, so der offizielle Name, dem Ende zu. Daraus lässt sich schließen, dass es die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) gerade mal seit 15 Jahren offiziell gibt. Doch wer steckt dahinter? Wer macht da mit wem gemeinsame Sache? Und was ist das überhaupt für eine Sache? DOKTUS klärt auf, was hinter der GDA steckt.
Warum gibt es die GDA?
Der Arbeitsschutz basiert in Deutschland auf einem dualen System. Einerseits gibt es den staatlichen Arbeitsschutz. Er ist verantwortlich dafür, dass Gesetze und Verordnungen eingehalten werden, und gründet auf dem Arbeitsschutzgesetz sowie zahlreichen Verordnungen, wie zum Beispiel der Gefahrstoffverordnung, die Arbeitsstättenverordnung oder die Baustellenverordnung. Die Zuständigkeit liegt bei den Ländern und damit bei den Gewerbeaufsichtsämtern, Ämtern für Arbeitsschutz und Landesämtern für Arbeitsschutz. Sie überwachen, dass Gesetze und Verordnungen eingehalten werden und ergreifen Maßnahmen, wenn das nicht geschieht, oder wenn Gefahren drohen.
Die andere Säule des Arbeitsschutzes ist die Gesetzliche Unfallversicherung, getragen von der DGUV, unter deren Dach sich die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen scharen. Deren Aufgabe ist die Prävention, für die Regeln und Unfallverhütungsvorschriften herausgegeben werden, die Rehabilitation in Form von Heilbehandlungen und Wiedereingliederungsmaßnahmen sowie Entschädigungen wie Renten, Verletztengeld oder Hinterbliebenen-Leistungen.
Obwohl die Aufgabenfelder unterschiedlich definiert sind, gab es in der Vergangenheit immer wieder Überschneidungen. So konnte zum Beispiel einerseits die Gewerbeaufsicht Unternehmen prüfen, aber auch die Berufsgenossenschaft auf der anderen Seite. So konnte es vorkommen, dass Unternehmen in kurzer Zeit gleich zwei Mal Besuch bekamen. Einmal vom Gewerbeaufsichtsamt und dann von der zuständigen Berufsgenossenschaft. Auch bei Beratung und Informationen gab es Redundanzen. Im Herbst 2007 einigten sich Bund, Länder und die DGUV darauf, in der Gemeinsamen Deutschen Arbeitssicherheitsstrategie zusammen zu arbeiten. Rechtlich wurde das mit dem Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) und der Ergänzung des Sozialgesetzbuches VII verankert.
Was ist eine GDA Periode?
Für eine fünf Jahre währende Periode werden Ziele formuliert und Schwerpunkte festgelegt. In der sich dem Ende zuneigenden 3. Periode sollten insgesamt 200.000 Betriebe besichtigt werden, davon 150.000 Betriebe mit 1–249 Beschäftigten, ausgewählt nach gefährdungsorientierten Kriterien. Außerdem wurden 50.000 Betriebe mit 20 bis 99 Beschäftigten zufällig besucht. Die Zahlen zeigen schon, dass in der 3. Periode Klein- und Mittelständische Unternehmen im Fokus standen. Das Motto dieser Periode lautet: „Arbeit sicher und gesund gestalten: Prävention mit Hilfe der Gefährdungsbeurteilung“. Es gab drei Thematische Schwerpunkte: Muskel-Skelett-Belastungen: Prävention von körperlichen Belastungen, zum Beispiel durch ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Psychische Belastungen: Förderung mentaler Gesundheit durch gute Arbeitsorganisation und Stressprävention. Sicherer Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen: Schutzmaßnahmen und Sensibilisierung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen. Zum festen Bestandteil der GDA-Periode gehört auch der Deutsche Arbeitsschutzpreis, der alle zwei Jahre in vier Kategorien verliehen wird und mit 10.000 Euro dotiert ist. Ausgezeichnet werden Branchen, Unternehmen aber auch Einzelpersonen, die sich um den Arbeitsschutz in besonders kreativer und effektiver Weise verdient gemacht haben.
Wie geht es mit der 4. GDA-Periode weiter?
Wenn die 3. Periode vorbei ist, wird erst einmal Bilanz gezogen, doch die Periode 4 ist bereits in Vorbereitung und soll vom 30. September bis 1. Oktober 2026 in Dresden beim nächsten Arbeitsschutzforum vorbereitet werden. Einige Eckpunkte sind bereits bekannt. So soll das Motto lauten: „Gemeinsam voran gehen“. Favoriten auf die Schwerpunktthemen sind: Digitalisierung und Arbeitsschutz: Umgang mit neuen Technologien und deren Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit. Demografischer Wandel: Anpassung des Arbeitsschutzes an eine alternde Erwerbsbevölkerung. Resilienz und Krisenfestigkeit: Lehren aus der Corona-Pandemie für zukünftige Belastungssituationen. Ob sie es dann am Ende auch wirklich werden, wird erst die Tagung in Dresden entscheiden.
Peter S. Kaspar
Bildquelle: Fotolia