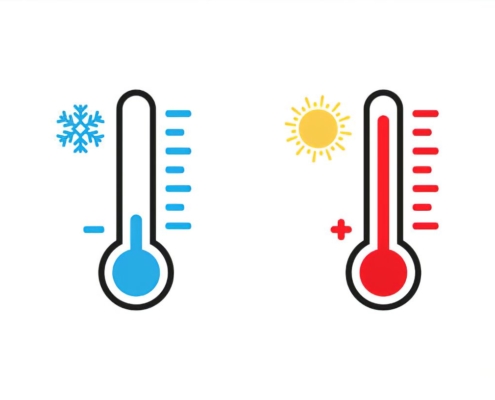Wider die Wut
Wenn es richtig heiß wird, bringt das am Arbeitsplatz oft eine Menge Probleme mit sich. Es kommt zu Dehydrierung, andere haben Schwierigkeiten mit dem Kreislauf, Kopfschmerzen oder Erschöpfung können alles Folgen übermäßiger Hitze sein. Es gibt eine Menge Handlungsempfehlungen und Vorschriften, die verhindern sollen, dass Beschäftigte diesen Risiken ausgesetzt sind. Eine Folge von Hitze bleibt allerdings häufig unerwähnt und die kann unter Umständen nicht nur katastrophale Folgen für den Einzelnen, sondern auch für die Gruppe haben. Es geht um Wut. Es geht um Brüllen, umgetretene Papierkörbe, zerrissene Papiere oder im schlimmsten Fall sogar um Handgreiflichkeiten. Hitze ist nicht der einzige Auslöser von Wutanfällen, doch während Hitzewellen steigen sie überall bedenklich an, ob im Arbeitsumfeld, im öffentlichen Raum oder in den eigenen vier Wänden. Zumindest, wenn es in einem Betrieb passiert, können Unternehmen schon im Vorfeld Strategien für eine Deeskalation entwickeln. Im Übrigen sind hohe Temperaturen bei weitem nicht die einzigen externen Wut-Trigger. DOKTUS hat sich mit dem Thema Wut genauer beschäftigt.
Was macht wann wütend?
Zunächst die gute Nachricht: Das Werwolf-Syndrom gibt es nicht. Die Vermutung, dass bei Vollmond das Aggressionspotential wächst, es zu mehr Wutausbrüchen oder gar zu Gewalttaten kommt, lässt sich wissenschaftlich nicht belegen. Lediglich eine kleine Studie in Australien hat einen wenig signifikanten Anstieg von Wutanfällen bei Menschen gemessen, die sowieso schon über ein hohes Aggressionspotential verfügten. Ganz anders sieht es da mit der Hitze aus. Wenn die Sonne richtig vom Himmel brennt, neigen selbst friedliche Menschen manchmal dazu, auszurasten. Eine ähnliche Auswirkung hat andauernder Lärm. Bohren, Hämmern und Sägen setzen dem Nervenkostüm bisweilen ziemlich zu. Diese äußeren Umstände lassen sich in der Regel nicht einfach abstellen. Also muss man lernen, damit umzugehen. Doch dann gibt es noch individuelle Wut-Erzeuger, die sich dem Einfluss des Arbeitgebers ebenfalls entziehen. Zum Beispiel kann Schlafmangel zu Wutanfällen führen, ebenso wie der Missbrauch von Drogen oder Alkohol.
Was tun, wenn’s knallt?
Stichwort Nummer eins ist stets: Deeskalation. Sie ist bei einem Wutausbruch die höchste Maxime. Jedes falsche Wort, jede missverstandene Geste kann die Situation noch schlimmer machen. Der Gegenüber sollte dem Wütenden eine Gelassenheit spiegeln, die sich idealerweise auf ihn überträgt. Nicht empfehlenswert ist in dieser Phase direkter Körperkontakt, also ein freundliches Schulterklopfen oder Ähnliches. Das könnte als Angriff fehlgedeutet werden. Apropos Angriff: Sollte die Gefahr bestehen, dass der Wutanfall zu einer körperlichen Auseinandersetzung führen könnte, muss die erste Maßnahme sein, Distanz zu schaffen, um damit einen möglichen Angriff zu erschweren. Wer in diesem Moment vermittelnd zwischen den Parteien steht, sollte auf jeden Fall völlig neutral bleiben und jegliche Schuldzuweisung in die eine oder andere Richtung unterlassen. Die Kommunikation sollte in kurzen und klar verständlichen Sätzen erfolgen. Sie sollten auch ein Anerkennen der Situation beinhalten, ohne sie zu werten. Noch wichtiger ist, dem Betroffenen Raum für Erklärungen zu geben.
Die Phase 2
Wenn es gelungen ist, die erste Wut zu dämpfen, ist die Gefahr noch nicht gebannt, aber der Boden eines ersten Gesprächs bereitet. Dazu sollte man den Wütenden die Gelegenheit geben, sich in einem geschützten Raum, abseits der Kollegen oder anderer Zuhörer zu äußern. Das ist aus Gründen der Gesichtswahrung unbedingt erforderlich. In einem öffentlicheren Rahmen kann schnell eine Tribunal-Situation entstehen, die das bislang Erreichte wieder zerstören könnte. In dem Gespräch werden dann die Gründe für den Wutausbruch erörtert. Oft stellt sich heraus, dass es hinter dem aktuellen Auslöser noch tieferliegende Gründe gibt, die eine schwelende Wut verursacht haben. Meist folgt ein Wutausbruch nur auf jenen letzten Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen bringt. In dem Gespräch wird nicht nach dem Tropfen gesucht, sondern der ganze Inhalt des Fasses ergründet. Auch wenn am Ende vieles verständlich sein sollte, so gilt es trotzdem, klare Grenzen für die Zukunft aufzuzeigen. Ein Wutausbruch, egal ob verbal oder körperlich ausgetragen, ist stets ein Akt der Gewalt, der am Arbeitsplatz nicht zu tolerieren ist.
Finalisierung
Hat man die Ursachen gründlich erforscht, geht es darum, mögliche Lösungen für die Zukunft zu finden. Zu einer nachhaltigen Konfliktlösung gehören auch Angebote an den Betroffenen in Form von Unterstützungsmöglichkeiten. Das können Programme, Gespräche oder Coachings sein. Wenn objektiv erkennbar interne Probleme zu der Situation geführt haben, sollte auch klar kommuniziert werden, wie und wann diese Probleme angegangen und abgestellt werden. Zu guter Letzt sollte das alles auch genau protokoliert werden. Transparenz ist dabei ein wichtiges Stichwort. So können auch andere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Führungskräfte von den erarbeiteten Lösungen profitieren.
Peter S. Kaspar
Bildquelle: iStock, mrjo2405