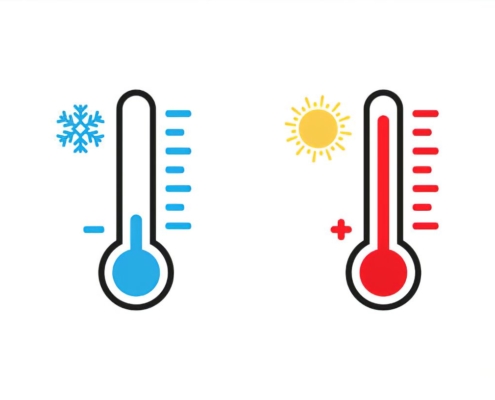Präventiv oder naiv
Man kennt das ja: Der beste Schutz vor Regen ist immer noch ein Regenschirm – aber nicht, um bei einem Guss trocken zu bleiben. Vielmehr ist es doch häufig so, dass man einen Regenschirm mitnimmt – und dann regnet es überhaupt nicht. Vergisst man ihn bei unklarer Wetterlage, dann ist es fast schon garantiert, dass man in einen Schauer rennt. Natürlich ist diese Analogie ein wenig schräg, aber sie zeigt auf etwas ironische Weise, worum es beim Präventions-Paradoxon geht. Wenn etwas passieren würde, wäre ich ja vielleicht geschützt, aber es passiert ja eh nichts, oder doch? Während der Corona-Pandemie wurde der Begriff Präventions-Paradox berühmt. Eigentlich ging es dabei um den Sinn oder Unsinn von Corona-Schutzimpfungen. DOKTUS zeigt, wie sich das Prinzip nicht nur auf die Arbeitsmedizin, sondern den ganzen Arbeitsschutz übertragen lässt.
Was nicht passiert, lässt sich nicht beweisen
Wer Vorsorge betreibt, handelt zwar in der Regel klug, hat aber immer ein Problem. Hat die Vorsorge nun ein Unglück verhindert oder wäre ja ohnehin nichts passiert? Bricht ein Brand aus, ist für jeden ersichtlich, dass die Feuerwehr die Flammen bekämpft und am Ende löscht. Wenn der Sicherheitsbeauftragte eines Unternehmens eine Brandlast identifiziert, wird das nicht etwa als Heldentat gepriesen, sondern gar als Störung des Arbeitsablaufs moniert, weil irgendjemand diesen alten Krempel ja wegräumen muss. Und wer behauptet denn, dass der Müllhaufen jemals in Brand geraten wäre? Noch ein wenig absurder wird es bei betriebsärztlichen Vorsorgeuntersuchungen. Solange man nicht untersucht wird, solange ist man gesund. Es hat etwas von Schrödingers Katze, die gleichzeitig tot und lebendig ist – solange man die Kiste nicht öffnet. Tatsächlich handeln manche Menschen so, als würde eine betriebsmedizinische Untersuchung eine Berufskrankheit überhaupt erst auslösen und finden es schlauer, sich gar nicht erst einer Untersuchung zu stellen. Hier zeigt sich dann ein klassischer Aspekt des Präventions-Paradoxons. Für den Einzelnen kann das Ergebnis in der Tat sehr schlimm sein. In der Masse jedoch sorgt die Vorsorgeuntersuchung dafür, dass sich die Situation in einem bestimmten beruflichen Segment deutlich verbessert.
Die Statistik ist der Freund der Prävention
Wenn Präventionsmaßnahmen Erfolg haben, lässt sich das meist nur auf statistischem Wege untermauern. Es braucht schon ein ziemlich ausgedehntes Zahlenwerk, um zu beweisen, dass Vorsorgemaßnahmen tatsächlich Nutzen gezeigt haben. Wenn etwa nach einer sicherheitsrelevanten Änderung um Unternehmen im ersten Monat die Unfälle zurückgehen, ist das noch kein Beweis dafür, dass die Änderung etwas gebracht hat. Sinken die Unfallzahlen auch in den folgenden Monaten, wird sich der Eindruck verfestigen, dass die neue Maßnahme zu einem Erfolg geführt hat. Trotzdem wird die Kritik nie ganz verstummen. Ein interessantes Beispiel liefert sie Einführung der Anschnallpflicht in PKWs. Zu Beginn 70er Jahre des 20. Jahrhunderts starben auf westdeutschen Straßen im Jahr mehr als 21.000 Menschen. Das führte zu der kontroversen Diskussion über die Einführung der Gurtpflicht. Die kam 1976. An den Opferzahlen bei Verkehrsunfällen änderte sich zunächst wenig. Die durchschnittliche Anschnallquote lag bei rund 50 Prozent. Die Gurtmuffel fühlten sich bestätigt. Erst acht Jahre später änderte sich alles schlagartig, als nämlich 40 DM für nicht angeschnalltes Fahren fällig wurde. Die Anschnallzahlen gingen hoch, die Verkehrstoten runter. Heute gibt es praktisch niemanden mehr, der daran zweifelt, dass die Gurtpflicht die Zahl der Verkehrstoten verringert hat. Die Zahl der Todesopfer bei Verkehrsunfällen liegt insgesamt nur noch bei ca. 2.700 pro Jahr – im gesamten Bundesgebiet. In Westdeutschland sind es rund 2.100 Tote, also nur noch ein Zehntel wie Anfang der 70er Jahre – und das, obwohl der Autoverkehr massiv zugenommen hat. Allerdings gehört die Anschnallpflicht nur zu einem Bündel von Präventiv-Maßnahmen, die offensichtlich in den letzten 50 Jahren gegriffen haben.
Akzeptanz in Unternehmen
Viele Unternehmen haben inzwischen längst erkannt, dass viele Arbeitsschutzmaßnahmen nicht nur vernünftig und notwendig sind, sondern dass sie sich am Ende auch tatsächlich auszahlen. Allerdings ist es nicht immer einfach, auch die Belegschaft davon zu überzeugen. Neue und notwendige Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zu Verbesserung der Gesundheit am Arbeitsplatz unterliegen immer wieder dem Zweifel. „Muss das denn sein? Das bringt doch nichts! Früher gings auch ohne“, sind gern gehandelte Argumente, mit denen man sich gegen Neuerungen zu Wehr setzt. Eine offene und transparente Unternehmenskultur trägt dann zur Akzeptanz bei. Wie eine kommunikative Unternehmenskultur in Sachen Arbeitsschutz und Betriebsgesundheit funktioniert, weiß DOKTUS. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie auf den Link oder rufen Sie uns an.
Peter S. Kaspar
Bildquelle: Fotolia